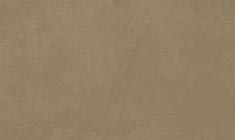Die Corona-Krise hat die Hygiene der Luft, die wir atmen und der Oberflächen, die wir berühren, in den Vordergrund gerückt. Sie beschleunigte die Entwicklung neuer Materialien und Oberflächen.
Aktueller denn je, ist CMF eine Abkürzung für Colours, Materials, Finishes also Farben, Materialien und Oberflächen, ein Bereich des Industriedesigns, der sich mit der farblichen, taktilen und dekorativen Gestaltung von Produkten und Räumen befasst. Ausschlaggebend waren hier die Studien von Clino Trini Castelli, aber auch von Ettore Sottsass und Andrea Branzi, die sich in den 1970er und 1980er Jahren intensiv mit dem Erscheinungsbild von damals neuen Materialien (Kunststoffe, Laminate, usw.) auseinandersetzten. Wir erleben derzeit einen neuen Umbruch, dessen kultureller Niederschlag gelenkt werden muss, und die Technologie wird dabei ein hervorragendes Instrument sein.
Was sind die neuen Horizonte des Oberflächendesigns?
Ein besonders aktuelles Thema ist die Haptik. Die Corona-Krise hat das haptische und olfaktorische Erleben sowie die Qualität und Hygiene der Luft, die wir atmen und der Oberflächen, die wir berühren, in den Vordergrund gerückt.
Alle hygieneaktiven, umweltfreundlichen und antibakteriellen Produkte werden auf den relevanten Märkten zweifelsohne einen Sprung nach vorn machen.
Ein weiteres Thema ist das der technologischen Beschichtungen von Oberflächen. Gerade bei den Fliesenherstellern wurden hier in den letzten Jahren große Fortschritte durch antibakterielle, rutschhemmende, durchgefärbte und dekorative Lösungen erzielt, für die auch die Full-HD-Digitaldrucktechnik zum Einsatz kommt. Digitalisierung und neue Produktionsprozesse schaffen die Möglichkeit, auch jenseits des Üblichen und Gewohnten zu experimentieren. Hier ein Beispiel. Schäume und poröse Produkte haben sich erst auf dem Markt etabliert, nachdem sie mit reinigungsfähigen Beschichtungen angeboten wurden. Seit Rem Koolhaas in der Fondazione Prada unverblendeten Aluminiumschaum verbaut hat, wurde der Weg für eine neue Ästhetik und eine ganze Produktkategorie geebnet, die wir sonst nie in diesem Ausmaß gesehen hätten.
Sind es also Planer oder Unternehmen, die als Trendsetter fungieren?
Große Unternehmen haben auch diese Aufgabe, also innovative Produkte hervorzubringen, die Trends setzen und den Weg für neue Ausdrucksformen freigeben.
Von wenigen Branchen gehen so übergreifende Trends wie von der Modewelt aus; ich weiß, dass ich etwas sage, das auf der Hand liegt. Modeaccessoires und ihre Ausarbeitung sind unglaublich eng mit der Welt der Haptik von Oberflächen in Innenbereichen verbunden. Modetrends erreichen nach ungefähr eineinhalb Jahren die Interior-Design-Branche.
Auch die Kosmetikbranche ist ein Vorreiter neuer Trends, die wir dann in anderen Bereichen wiederfinden. Cremes haben neue Konsistenzen und Texturen (Powdered, Polish, Glossy usw.). Wenn wir diese Texturen, die wir im weiteren Sinne als „Finish“ ansehen können, auf unserer Haut akzeptieren, dann bedeutet dies, dass wir auch bereit sind, sie auf unseren Gebrauchsgegenständen oder auf den Einrichtungen und Oberflächen in unseren Wohnungen anzunehmen.
Anstatt sich auf Trends zu konzentrieren, müsste der kulturelle Wandel gefördert werden, der Zeit braucht und mehr mit dem Bausektor als mit der Einrichtungsbranche verbunden ist. Innenarchitektur und Interior Design sind unterschiedliche Sachgebiete, weshalb sie in ihrer Entwicklung nicht Hand in Hand gehen.
Welche Aspekte werden einen tiefgreifenden Einfluss auf die Wahrnehmung und Wahl von Oberflächen haben?
In unseren vier Wänden haben LEDs und OLEDs die Lichtlandschaft verändert. Demzufolge müssen auch die Oberflächen anders konzipiert werden. Eine Oberfläche wird nicht nur physisch, sondern auch visuell wahrgenommen, und das Licht ist dabei ein ausschlaggebendes Element. Auch dieser Aspekt ist den Unternehmen der Keramikbranche, die an Mattabstufungen von Glasuren arbeiten, um einen angenehmen visuellen Eindruck und eine bessere Lichtreflexion zu erhalten, bestens bekannt. Im Labor der Technischen Hochschule in Mailand, das ich mit dem israelischen Designer Ron Arad betreue, stellen wir täglich fest, dass die neuen Generationen von Planern wenig Wert auf die Qualität von Oberflächen legen. Oft betonen sie die in den Farbpaletten der Programme, mit denen sie arbeiten, zur Verfügung stehenden Farben bis ins Extreme. Nur wenige sind zu einem feinfühligen Umgang mit Farbtönen, Granulometrien und Texturen in der Lage.
Wenn sie mit Materialien arbeiten und diese in ihre Programme importieren, dann stellen wir fest, dass sie keine Vorstellung von den Projektmaßstäben haben. Oft werden Texturen verwendet – z.B. die von Fliesen in Holzoptik – und auf sehr kleine oder sehr große Formate übertragen. Dies führt zu einer neuen Interpretation der Materialien und eröffnet unbewusst neue Bedeutungen und neue Ausdrucksformen. Diese Vorgehenswese ist direkt auf die Gewohnheit des Vergrößerns und Verkleinerns mit der Zoomfunktion auf dem Bildschirm des Smartphones zurückzuführen, eine Gewohnheit, die also auch in der Planungsphase übernommen wird. Diese jungen Generationen leben in Wohnungen des 20. Jahrhunderts, bewegen sich aber gleichzeitig und ständig in digitalen Räumen. Aus der Hybridisierung der beiden Welten, der digitalen und der analogen, werden neue Kategorien von Oberflächen entstehen.
Anna Barbara, Architektin und außerordentliche Professorin für Interior and Spacial Design an der Technischen Hochschule in Mailand. Sie lehrte als Gastprofessorin an der Tsinghua University, Kunst- und Designschule, Peking (China); an der Kookmin University, Seoul (Südkorea); an der Hosei University, Tokyo (Japan) und an Universitäten in den USA, Frankreich, Thailand, Brasilien, Jordanien, in den Vereinten Arabischen Emiraten, Indien, usw. Im Jahr 2000 war sie Stipendiatin der Canon Foundation in Japan. Sie erhielt eine Auszeichnung beim Premio Borromini Architekturpreis; ihre Projekte wurden von Archmarathon und ADI-Index 2019 ausgewählt. Die Beziehungen zwischen Sinnen, Zeit, Räumen und Design sind die Schwerpunktthemen ihrer Lehrtätigkeit, auf Konferenzen, in Veröffentlichungen, Kuratorien und Facharbeiten.
Sie entwarf internationale sensorische Projekte für: Trinity, Pioneer, Panasonic, Ibiden, Honda, Fujitsu, Suruga, Lexus, Toyota, Ford, Exmovere, Jadeluck, International Robotics, Fissan, Lancôme, Symrise, Guerlain, Condé Nast, Cleaf, Venini, AAD in Abu Dhabi, Acell, Natura, Vantone, Vats, usw. in China, Japan, USA, Europa, Großbritannien, und in den Vereinten Arabischen Emiraten als Gründerin von SenseLab.
Sie ist Autorin von Storie di Architettura attraverso sensi (Bruno Mondadori, 2000), Invisible Architectures. Experiencing places through the senses of smell (Skira, 2006) und Sensi, tempo e architettura (Postmedia Books, 2012), Sensefulness, new paradigms for Spatial Design (Postmedia Books, 2019) und von vielen anderen Veröffentlichungen. 2021 wird sie POLI.design, den ersten internationalen Kurs für Olfactive Spacial Design starten.